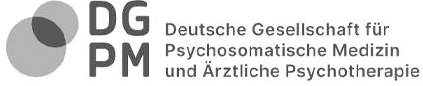Depression
Die Depression ist ein Volksleiden und stellt mit über 4 Millionen Betroffenen allein in Deutschland die häufigste psychische Erkrankung dar. Allerdings werden nur etwa 6-9% aller Fälle behandelt. Die hohe Dunkelziffer ist darauf zurückzuführen, dass die Depression selbst heute immer noch als Makel gilt und viele Betroffene sich diese Erkrankung nicht zugestehen wollen.
Die Depression gehört in den Formenkreis der psychischen Erkrankungen. Es handelt sich dabei um eine psychische Störung, die zunächst mit einer starken Niedergeschlagenheit und dem Verlust der Lebensfreude einhergeht.
Bereits leichte Formen einer Depression können erhebliche Leistungseinbußen bewirken und mit einer deutlichen Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergehen. Schwere Formen können zu Arbeitsunfähigkeit bis hin zum Suizid führen. Aus diesem Grund ist es dringend empfehlenswert sich bei einer Depression bereits frühzeitig (spätestens, wenn die Symptome merklich das Leben oder das Umfeld beeinträchtigen) qualifizierte professionelle Hilfe zu holen, am besten von einem erfahrenen Spezialisten.
Die Depression zählt zu den komplexesten psychischen Erkrankungen, und existiert in sehr vielen verschiedenen Formen. Dieser Artikel soll Ihnen, Patienten und Interessenten im Raum München, einen fundierten Überblick verschaffen.
Häufigkeit
Die Depression ist die am häufigsten auftretende psychische Erkrankung. Allein in Deutschland sind Schätzungen zufolge vier Millionen Menschen von einer Depression betroffen und rund zehn Millionen Menschen bis zum 65. Lebensjahr haben eine Depression erlitten, sodass fast jeder Mensch in seinem Leben mindestens einmal mit einer Depression konfrontiert ist. Die Krankheitslast durch Depressionen, etwa in Form von Arbeitsunfähigkeiten, stationären Behandlungen und Frühverrentungen, ist in Deutschland in den letzten Jahren stark angestiegen. Laut WHO-Prognose wird im Jahr 2020 die Erschöpfungsdepression Weltspitzenreiter aller Krankheiten sein. Es ist von einem Zusammenwirken mehrerer Ursachen auszugehen: sowohl biologische Faktoren als auch entwicklungsgeschichtliche Erfahrungen, aktuelle Ereignisse und konflikthafte Fehlverarbeitungsmuster spielen eine Rolle. Stressvolle Lebensereignisse stellen hierbei einen bedeutenden Risikofaktor für Depressionen dar. Auch in München zählt die Depression zu den häufigsten psychischen Erkrankungen.
Symptome der Depression
Charakteristisch für die Depression bzw. typisch sind dabei folgende Symptom-Bilder:
- Initial: allgemein gedrückte und traurige Stimmung, z.T. auch als vermehrte Reizbarkeit und Ängstlichkeit, dabei Stimmungseinengung, also Verlust der Fähigkeit zur Freude und Trauer, der Patient kann trotz positiven Zuspruchs nicht aufgemuntert werden.
- Ein klassischer Hinweis ist der Interessenverlust und der soziale Rückzug bis hin zur sozialen Selbstisolation.
- Es folgen der verminderte Antrieb, die gesteigerte Ermüdbarkeit, Konzentrationsstörungen und Entscheidungsprobleme, die Schwierigkeit, eine Entscheidung zu treffen.
Bei einer schweren depressiven Form kann der Antrieb so stark gehemmt sein, dass auch einfachste Tätigkeiten wie Körperpflege, Einkaufen, oder Abwaschen zur großen Belastung werden und aus eigener Kraft nicht mehr bewältigt werden können. „Ein Gefühl der Gefühllosigkeit“, bzw. ein Gefühl anhaltender innerer Leere wird zunehmend beobachtet.
Darüber hinaus lassen sich folgende Zusatzsymptome beobachten:
Verlust des Selbstvertrauens bzw. des Selbstwertgefühls, Gefühl der Hoffnungslosigkeit, Minderwertigkeit, Gefühl der Hilflosigkeit oder ein Gefühl der Gefühllosigkeit. Ferner kann es bis hin zur Selbstentwertung und übersteigerten Schuldgefühlen kommen.
- Vermindertes Denk- oder Konzentrationsvermögen
- Selbstvorwürfe oder unangemessene Schuldgefühle
- psychomotorische Hemmung oder Unruhe
- Schlafstörungen
- verminderter (selten auch gesteigerter) Appetit mit Gewichtsveränderung
- Suizidgedanken oder -handlungen: Schwer depressiv Erkrankte empfinden oft eine völlige Sinnlosigkeit ihres Lebens. Häufig führt dieser qualvolle Zustand zu latenter oder akuter Suizidalität. Man geht davon aus, dass rund die Hälfte der Menschen, die einen Suizid begehen, an einer Depression gelitten haben. Bei der Depression handelt es sich daher um eine sehr ernste Erkrankung, die umfassender Therapie bedarf.
Zu den klassischen klinischen Merkmalen zählen:
- Angst und Anspannung, übertriebene, der Realität nicht entsprechende Zukunftsängste, Zukunftssorgen, Bagatellstörungen im Bereich des eigenen Körpers führen zu starker Beunruhigung mit hypochondrischen Tendenzen.
- kognitiven Verzerrungen z. B. in Form selektiver Wahrnehmung negativer Ereignisse. Negative Gedanken und Eindrücke werden über- und positive Aspekte nicht adäquat bewertet. Zusätzlich negative Sicht von Selbst, Welt und Zukunft.
- Meistens ist der Schlaf gestört und/oder nicht erholsam und das Aufstehen am Morgen kann Probleme bereiten (sog. Morgentief)
- Allgemeine Passivität
- Sozialer Rückzug und Ablehnung durch Andere. Das Gefühlsleben ist teilweise eingeengt, was zum Verlust des Interesses an der Umwelt führen kann.
- Verschlechterung der Partner- und Familienbeziehungen. Teilweise auch Verminderung des sexuellen Interesses.
Depressive Erkrankungen gehen oft mit körperlichen Symptomen einher, sogenannten Vitalstörungen, wie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, häufig auch mit Schmerzen in ganz unterschiedlichen Körperregionen, am typischsten mit einem quälenden Druckgefühl auf der Brust.
Alle Symptome der Depression können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Man spricht deshalb allgemein von einer leichten, mittleren oder schweren Depression.
Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Symptomatik:
Die Symptomatik einer Depression kann sich bei Frauen und Männern auf unterschiedliche Weise ausdrücken. Bei den Kernsymptomen sind die Unterschiede sehr gering. Während bei Frauen eher Phänomene wie Mutlosigkeit und Grübeln verstärkt zu beobachten sind, gibt es bei Männern deutliche Hinweise darauf, dass eine Depression sich auch in einer Tendenz zu aggressivem Verhalten auswirken kann, es kommt vermehrt zu Klagen über Schlaflosigkeit und deutlich mehr Anzeichen von Reizbarkeit, Verstimmung, schnellem Aufbrausen, Wutanfällen, Unzufriedenheit mit sich und anderen, Neigung zu Vorwürfen und nachtragendem Verhalten, erhöhter Risikobereitschaft, exzessivem Sporttreiben, sozial unangepasstem Verhalten, ausgedehntem Alkohol- und Nikotinkonsum sowie einem erhöhten Selbsttötungsrisiko. Bei Frauen werden Depressionen im Durchschnitt doppelt so oft wie bei Männern diagnostiziert. Dies kann auf eine verstärkte genetische Disposition von Frauen zur Depression hinweisen, aber auch mit den unterschiedlichen sozialen Rollen und Zuschreibungen zusammenhängen.
Klassifikation
Im Rahmen des ICD-10 wird die Depression als depressive Episode bezeichnet, und man unterscheidet nach dem ICD-10 generell zwischen einer leichten, mittleren und schweren Depression, wobei letztere auch in Kombination mit psychotischen Symptomen erscheinen kann. Tritt die Depression einmalig auf spricht man von einer depressiven Episode.
Über viele Jahre immer wiederkehrende Depressionen werden nach dem ICD-10 als eigenständiges Krankheitsbild betrachtet – man nennt diese rezidivierende depressive Störung.
Abzugrenzen ist eine Sonderform, die früher als „manisch-depressiv“ bezeichnet wurde. Sie wird heute bipolare affektive Störung genannt. Bei dieser Sonderform -wechseln sich depressive Phasen und manische Phasen ab. Da diese Sonderform mit einer normalen Depression nicht vergleichbar ist, werden wir dieser in Kürze einen eigenen Beitrag widmen.
Diagnose der Depression
Die Stellung der Diagnose „Depression“ zählt zu den großen Herausforderungen in der Medizin, v. a. die Depression zudem richtig zu klassifizieren und die korrekte Form zu bestimmen. Die erste Anlaufadresse ist in der Regel der Hausarzt. Aufgrund der teilweise relativ klaren Symptome sollte eigentlich jeder Hausarzt eine Depression erkennen. In der Praxis liegt aber die Fehlerquote bereits hier bei über 50 %. Ferner ist festzustellen, dass die Diagnose selbst zumindest die Klassifikation und Form betreffend ebenso in über 50% der Fälle falsch ist.
Zur genaueren Diagnosestellung sind deshalb zunächst eingehende Arzt-Patienten-Gespräche erforderlich. Äußert der Hausarzt den Verdacht auf eine Depression sollte von dessen Seite eine Überweisung an einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder einen Psychologen erfolgen, damit die Diagnose bestätigt werden kann. Tut der Hausarzt das nicht, empfehlen wir grundsätzlich Eigeninitiative zu ergreifen, und sich in Ihrem eigenen Interesse eine zweite fachliche Meinung einzuholen. Denn die richtige Diagnose ist zwingende Grundvoraussetzung für eine (dauerhaft) erfolgreiche Therapie.
Zur genaueren Klassifizierung stehen dem Facharzt und Psychologen neben der genauen Erhebung der Anamnese verschiedene Verfahren zur Verfügung, z. B.:
- – Hamilton Depressionsskala (HAMD)
- – Fremdbeurteilung
- – Beck-Depressions-Inventar (BDI)
- – Inventar depressiver Syndrome (IDS)
Differentialdiagnosen
Im Rahmen der Diagnosestellung sind folgende andere mögliche Erkrankungen auszuschließen:
- – Perniziöse Anämie (Morbus Biermer) / Vitamin B12-Mangel
- – Erkrankung der Schilddrüse
- – sonstige Anämie
- – Fruktosemalabsortion
- – andere hirnorganische Krankheiten (z.B. Multiple Sklerose, Demenz)
- – Burnout
- – Anpassungsstörungen und Belastungsstörungen
- – andere affektive Erkrankungen
- – Nebenwirkungen von Medikamenten
Formen der Depression
Es existieren zahlreiche unterschiedliche Formen der Depression, welche oftmals gar nicht bekannt sind. Die Unterscheidung ist von großer Bedeutung, da den einzelnen Formen zum Teil völlig unterschiedliche Ursachen bzw. Auslöser zu Grunde liegen können.
Unterschiedliche Grundformen der Depression:
- Reaktive Depression. Diese Depression kann als Folge eines einschlägigen aktuellen Ereignisses auftreten, z. B. nach einer schweren
- Traumatisierung, einem Schicksalsschlag, Partnerverlust, Kindsverlust, Arbeitsplatzverlust, wirtschaftlicher Existenzverlust, etc.
- Erschöpfungsdepression. Diese wird verursacht durch länger andauernde Belastungsfaktoren im persönlichen oder beruflichen Umfeld.
- Neurotische Depression (Dysthymia). Mildere depressive Symptome, die jedoch über mehrere Jahre oder Jahrzehnte anhalten und oftmals bereits in der Jugend beginnen.
- Endogene Depression (majore Depression). Diese Depression erscheint ohne eine (zunächst) erkennbare Ursache.
- Larvierte Depression (eine Subspezies der endogenen Depression) auch „weiße“, „maskierte“ oder „somatisierte“ Depression genannt. Sie ist gekennzeichnet durch körperliche Beschwerden, hinter denen sich in Wirklichkeit einer Depression „versteckt“.
- Somatogene Depression als Folgeerscheinung von körperlichen Erkrankungen: Morbus Parkinson, Rheuma, M. Addison (Nebennierenrindeninsuffizienz), Hypothyreose, M. Alzheimer etc.
- Pharmakogene Depression als Folge von Medikamentennebenwirkungen (z.B. bei Hypertonus, Diabetes mellitus, Interferon-Gabe etc.)
- Agitierte Depression
- Atypische Depression
Weitere Formen:
- Die Winterdepression ist eine saisonal auftretende Form, für die ein Mangel an Sonnenlicht die Ursache zu sein scheint.
- Die Bezeichnung Altersdepression ist irreführend, da sich eine depressive Episode im Alter nicht von der in jungen Jahren unterscheidet. Allerdings erkranken Ältere häufiger an einer Depression als Jüngere. Dabei können zunehmende Vereinsamung, abnehmende soziale Kontakte aufgrund körperlicher Beeinträchtigung und Mangel an Perspektiven ursächlich dazu beitragen.
- Die Schwangerschaftsdepression kommt häufig aufgrund einer Anpassungsstörung während der Schwangerschaft zustande.
- Bei manchen Frauen kommt es nach der Geburt zu einer postpartalen Depression.
Ursachen der Depression
Die Ursachen der Depression sind heute noch nicht abschließend wissenschaftlich geklärt. Aufgrund der Komplexität geht man heute davon aus, dass zur Entstehung einer Depression mehrere Ursachen zusammenkommen. Als Auslöser gelten genetische Prädispositionen, die Persönlichkeit selbst, Prägungen der Kindheit und Jugend, verzerrte Wahrnehmungen und Kognitionen (Gedanken) sowie belastende aktuelle Lebensereignisse.
Genetische Ursachen
Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien belegen eine genetische Disposition für Depression. Zwillingsstudien zeigen, dass im Vergleich zu Effekten der gemeinsamen familiären Umgebung und Umwelt, genetischen Faktoren eine entscheidende Bedeutung
zukommt. Die Zwillingsstudien zeigen umgekehrt auch, dass die genetische Komponente nur ein Teilfaktor ist, beim Entstehen einer Depression spielen immer auch Umweltfaktoren eine Rolle. Es gibt allerdings kein isoliertes „Depressions-Gen“.
Neurobiologische Faktoren:
Des Weiteren sind bei einer Depression bestimmte Botenstoffe im Gehirn (Neurotransmitter) gestört, d. h. deren Konzentration ist entweder zu hoch oder zu niedrig oder die Verarbeitung in den Synapsen ist anfällig. Man bezeichnet diese Störung auch als Störung des serotonalen/noradrenalen Systems (an dieser Störung setzen z. B. Medikamente wie Antidepressiva an, welche diese Neurotransmitter-Spiegel künstlich verändern).
Neueste Studien weisen dabei in eine sehr interessante Richtung: Die bei der Depression auftretenden Neurotransmitter-Störungen beruhen höchst wahrscheinlich auf einer Fehlanpassung an chronischen Stress (Dis-Stress). Depressiven Menschen weisen eine erhöhte Konzentration des Stresshormons Cortisol auf. Neueste Erkenntnisse zeigen nun, dass die Folgen von Stress bestimmte Gehirnregionen verändern, und so die mögliche positive Stressverarbeitung im Gehirn gestört wird. Die daraus resultierende Depressionssymptomatik ist demnach eine Antwort auf die individuelle, fehlerhafte Stressverarbeitung.
Psychologische Modelle
In der Psychologie wurden ergänzend diverse Modelle entwickelt, welche die Ursache der Depression beschreiben. Sie bilden die Grundlage für die Psychotherapie, deren Wirkung heute im Zusammenhang mit den Hauptrichtungen wissenschaftlich erwiesen ist.
Erlernte Hilflosigkeit
Nach diesem Modell entstehen Depressionen als Folge von Gefühlen von Hilflosigkeit, die unkontrollierbaren negativen Situationen folgen. Mit anderen Worten: Situationen, die unüberwindbar erscheinen, begünstigen die Entstehung einer Depression.
Kognitionen
Negative Lebenserfahrungen können (im Laufe der Zeit immer stärker werdende) negative kognitive Schemata und Überzeugungen bilden. Betroffene „begehen“ somit Fehler im Denken. Sie werden immer negativer und pessimistischer in Bezug auf sich selbst, die Umwelt und die Realität. Man spricht deshalb auch von einer kognitiven Verzerrung der Realität. Diese negative Denkweise kann wiederum zu Depressionen führen. Im schlimmsten Fall sehen Betroffene Dinge derart negativ, dass dies nicht mehr einer objektiven Wirklichkeit entspricht, und als Psychosen einzuordnen sind (die schwerste Form der Depression).
Mangel an emotionaler Intelligenz
Ein Mangel an Fähigkeit mit zwischenmenschlichen Beziehungen und Konflikten umzugehen nebst einer negativen Wahrnehmung der Dinge führt zu Rückzug, Abgrenzung und einem
reduzierten (gestörten) sozialen Leben. Dies wiederum ist auf einen Mangel an emotionaler Intelligenz (Fähigkeit der rechten Gehirnhälfte) zurückzuführen, was die Entstehung einer Depression begünstigen kann.
Nicht vorhandene Protektoren
Jeder Mensch benötigt eine gewisse Anzahl positiver Lebensereignisse (Dinge, die einem „guttun“), die Spaß, Anreiz und Freude bringen. Fehlen diese (man spricht in der Psychologie von Verstärkern) verliert der Mensch irgendwann sein seelisches Gleichgewicht, und der Beginn einer negativen Abwärtsspirale beginnt.
Psychoanalytische Ursachen
In der Psychoanalyse/Tiefenpsychologie gilt die Depression als eine gegen den Betroffenen selbst gerichtete Aggression. Man geht davon aus, dass in der Jugend und/oder Kindheit Menschen, welche in bestimmten dysfunktionalen Familien/Beziehungssystemen und Umgebungsfaktoren aufwachsen, selbstschützende Verhaltensweisen als Kompensation entwickeln müssen, um problemlos zu funktionieren bzw. ein psychologisches Gleichgewicht herstellen zu können. Diese dauerhaft ungünstigen und selbstschädigenden Kompensationsmuster können die Entstehung einer Depression begünstigen. Einige dieser betroffenen Menschen können auch später Kompensationscharaktere entwickeln, wie z.B. Narzissmus, Helfersyndrom oder Größenwahn. Irgendwann bricht diese Persönlichkeitsstruktur zusammen und die bereits latent (seit Jahren) vorhandene Depression wird manifest.
Psychosoziale Aspekte und Gratifikationskrise
Negative Lebensumstände (Geldmangel, Arbeitsplatzprobleme, Stress, Eheprobleme, …) oder eine nie stattfindende Anerkennung begünstigen ebenfalls die Entstehung einer Depression, v. a. wenn eine genetische Disposition besteht.
Physiologische Ursachen
Des Weiteren sind zahlreiche rein physiologischen Ursachen zu nennen, die eine Depression hervorrufen können. Hierzu zählen ein Mangel an Sonnenlicht (Winterdepression), Erreger, Substanzen (z. B. pharmakogene Depression) und Hormone (postpartale Depression).
Therapie der Depression in München
Die Behandlung ist so komplex wie die Erkrankung selbst. Letztendlich entscheiden Form und Schwere der Depression, welche Therapie nun zunächst eingeleitet werden sollte. Im Vordergrund bzw. Ziel aller Maßnahmen ist es, den Leidensdruck des Betroffenen zu senken, die Stimmung zu verbessern, so dass er seinen Alltag wieder besser bewältigen kann.
Von akuten und schweren Formen abgesehen, die zunächst psychiatrisch behandelt werden müssen, gehört die Behandlung von Depressionen in den Bereich der Psychotherapie. Dabei sind sowohl von tiefenpsychologischer als auch verhaltenstherapeutischer Seite i. d. R. gute Behandlungserfolge zu erwarten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Depression ergänzend medikamentös zu behandeln.
- Allgemeine Therapiemaßnahmen
In vielen Fällen wird die Depression durch eine ambulante (kognitive) Verhaltenstherapie behandelt. Dabei wird versucht, negative Denkmuster in positive Umzuwandeln und insgesamt Anregungen zu geben, das Leben des Betroffenen anders, sprich positiver zu gestalten. Durch diese Therapie wird die Sichtweise des Patienten und damit die Aufmerksamkeit „step by step“ geändert. Der Patient erhält zudem durch den Therapeuten objektive und „gesunde“ Impulse, welche den Prozess fördern. Diese Therapie wird von einem Psychologen oder einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie durchgeführt.Des Weiteren werden zahlreiche Depressionen medikamentös behandelt, durch die Einnahme von Antidepressiva (Psychopharmaka). Allgemein gesprochen haben Antidepressiva die Aufgabe den Serotonin-/Noradrenalin-Spiegel wieder auszugleichen, was die Symptome der Depression senkt. Die Verschreibung der Medikamente erfolgt entweder durch den Hausarzt selbst oder durch den behandelnden Therapeuten.Das bei der Diagnostik und Therapie von Depression biographische und psychodynamische Zusammenhänge nicht außer Acht gelassen werden, dem tragen tiefenpsychologisch, bzw. psycho-analytische Ansätze in besonderem Maße Rechnung. Die Wechselwirkung äußerer Einflüsse und individueller Belastungen/Beschwerden sollte auch immer im Kontext der individuell erfahrenen lebens- und beziehungsgeschichtlichen (psychosozialen) Bedingungen und der sich daraus entwickelten Persönlichkeit gesehen werden. Sie tragen entschieden zur individuellen Anfälligkeit (Disposition) und Ausprägung der Depression bei. Dabei geht es in erster Linie um ein Verstehen dieser Variablen und deren Einfluss auf die erlebte Symptomatik. Ziel dieser Therapien ist jedoch immer die Bewältigung bzw. Verbesserung der aktuellen Beschwerden im Hier und Jetzt.Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, kognitive Verhaltenstherapie und die Vergabe von Antidepressiva stellen somit die Standarttherapien bei der Behandlung der Depression dar. Für die psychoanalytische Therapie sind die meisten Therapeuten nicht qualifiziert, da hierfür eine umfangreiche Zusatzausbildung erforderlich ist (Fachbezeichnung „Psychoanalytiker“). Bei der Wahl des Therapeuten ist es für Sie als Patient wichtig, dass Sie ein positives Gefühl zu Ihrem Therapeuten aufbauen können, und entsprechendes Vertrauen entsteht. Es ist für den Therapieerfolg absolut entscheidend, dass diese „Chemie stimmt“. Sollten das nicht der Fall sein, sollten Sie einen anderen Therapeuten wählen. In diesem Zuge ist es ratsam, zu Beginn einer jeden Therapie 1-5 Testsitzungen zu nehmen, sog. probatorische Sitzungen und sich danach erst endgültig zu entscheiden.
Die meisten Depressionen werden ambulant behandelt. Nur in absoluten Ausnahmefällen ist eine stationäre Therapie sinnvoll und notwendig. Bei ganz akuten und sehr schweren Fällen ist es medizinisch notwendig sofort zu intervenieren, v. a. wenn der Verdacht auf Suizid besteht. In diesen Fällen sollten sich Betroffene sofort an ihren Hausarzt, ihren behandelnden Facharzt/Psychotherapeuten oder einen psychiatrischen Notdienst wenden. Wenn Sie in Ihrem Umfeld so einen Fall beobachten, sollten Sie selbst aktiv werden. In den meisten Fällen können Selbstmordversuche verhindert werden, wenn man rechtzeitig entsprechende Anlaufstellen kontaktiert. Im Rahmen der psychiatrischen Intervention wird der Patient zunächst einmal stabilisiert, eine Therapie kann erst später beginnen oder fortgeführt werden.
- Therapiemaßnahmen unserer PraxisUnsere psychosomatisch-psychotherapeutische Praxis in München ist auf die Behandlung der Depression spezialisiert: Sie stellt einen unserer Hauptschwerpunkte dar. Ich habe im Laufe meiner zwanzigjährigen Tätigkeit als Chefarzt von diversen führenden Fachkliniken u. a. für die Behandlung der Depression eigene Therapiekonzepte entwickelt und verfeinert. Diese Ansätze haben zahlreiche Vorteile, v. a. die, dass wir in der Regel eine deutlich höhere (nachhaltige) Erfolgsrate erzielen. Auch ist der Therapieerfolg in unserer Praxis inzwischen objektiv messbar. Selbstverständlich bieten auch wir 1-5 probatorische Sitzungen an (Wichtigkeit s. o.).a) Diagnostik
Im ersten Schritt steht in unserer Praxis die Stellung der richtigen Diagnose bzw. die Bestimmung der genauen Klassifizierung und Form. Aus unserer Erfahrung kann bestätigt werden, dass über 50% aller Diagnosen im Zusammenhang mit der Depression falsch gestellt werden. Neben diversen klassischen Testverfahren nutzen wir dazu auch das von uns entwickelte PPL-Verfahren (Psychophysiolyse) über welches per Computer neuro-physiologische Vitalwerte gemessen werden. Ein weiterer großer Vorteil unserer Praxis ist, dass wir neben der klassischen Psychotherapie auch eine Facharztpraxis für psychosomatische Medizin sind. Aufgrund dieser Tatsache steht uns ein sehr großer Wissenspool zur Verfügung, der v. a. im Zusammenhang mit der Erkennung von lavierten Depressionen und Depressionen mit physiologischen Ursachen von entscheidender Bedeutung ist. Psychodiagnostische Testverfahren runden das Bild ab. Die richtige Diagnostik ist das A und O für eine erfolgreiche Therapie. Denn eine lavierte Depression ist anders zu behandeln als eine physiologisch bedingte, usw.
b) Therapie
Aufgrund der erfolgreichen Diagnostik erarbeiten wir dann in einem zweiten Schritt in Absprache mit Ihnen ein für Sie individuellen Therapieplan, der aus den folgenden Modulen bestehen kann.
Probatorische Sitzungen
Unsere Therapie beginnt immer mit 1-5 probatorischen Sitzungen (zu der Wichtigkeit s.o.).Psychopharmakotherapie und -beratung
Das Motto unserer Praxis in Bezug auf Psychopharmaka lautet: „Antidepressiva sind Medikamente, die nur eingesetzt werden sollten, wenn es nötig ist, aber dann die richtigen.“ Durch unseren fachärztlich-psychiatrischen Hintergrund und unsere internationale Vernetzung mit Kollegen besitzen wir ein sehr umfangreiches Knowhow in Bezug auf Psychopharmaka und Antidepressiva. Generell gilt, dass Antidepressiva Medikamente sind, und diese haben Nebenwirkungen. Des Weiteren ist das Spektrum an angebotenen Antidepressiva groß. Was für den einen Patienten gut ist, kann für den anderen schlecht oder wirkungslos sein. Unsere Erfahrung zeigt, dass Patienten, die an Depressionen leiden in einer Vielzahl von Fällen unnötig Medikamente verordnet werden, und meistens die falschen bzw. nicht die optimalen. Das liegt daran, dass bei den meisten Hausärzten nicht das erforderliche psycho-pharmakologische Fachwissen vorhanden ist. Zudem gilt, dass es zwar wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Antidepressiva in ca. 60-80% aller Fälle eine Stimmungsaufhellung bei der Depression bewirken, aber dauerhaft geheilt wird ein Patient dadurch i. d. R. nicht – dies geht nur über eine Psychotherapie oder eine Behandlung der auslösenden Ursachen. Im Gegenteil, Antidepressiva können u. U. zu Leistungseinbußen der mentalen Fähigkeiten führen. Aus diesen Gründen setzen wir Antidepressiva nur ein, wenn und solange es therapeutisch notwendig ist.Ursachenbehandlung
In einigen Fällen der Depression ist es sinnvoll, die die Depression auslösenden Ursachen vordergründig oder parallel zu behandeln. Zum Beispiel bei einer Winterdepression kann die ergänzende Einnahme von bestimmten Vitaminen oder das Nehmen von Sonnenbädern sinnvoll sein. Oder bei anderen physiologisch bedingten Depressionen kann eine begleitende Ernährung den Prozess unterstützen. Bei einer reaktiven Depression ist es zum Beispiel wichtig, eine therapeutische Unterstützung im Zusammenhang mit der Verarbeitung des auslösenden Ereignisses (Schock, Traumatisierung) zu liefern.Im Gegensatz zur Standardbehandlung der reinen Verhaltenstherapie verfolgen wir einen individual ausgerichteten integrativen Ansatz. Unsere langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass diese Kombination deutlich schnellere und v. a. länger anhaltende Therapieerfolge liefert. Gerade bei endogenen Depressionen, aber auch bei rezidivierenden Formen oder der lavierten Depression sind tiefenpsychologische Ansätze von entscheidendem Vorteil. Des Weiteren kommt hier unsere langjährige und umfangreiche Erfahrung zum Einsatz. Jeder Mensch ist anders, deswegen braucht jeder Mensch auch eine ganz individuelle Therapie.
PPL (Psychophysiolyse)
Unser PPL-Labor ermöglicht es uns den Therapieverlauf zu verfolgen, uns zwar anhand von objektiven Messungen. Im Rahmen von Einzel– oder auch Gruppensitzungen können bei der PPL-Therapie bestimmte Vitalwerte und die Stressverarbeitungsfähigkeit deutlich verbessert werden. Wie im Rahmen der Ursachen zur Depression beschrieben, stellen Stress und StressverarbeituDepression dar. Und diese Stressverarbeitungsfähigkeit wird im Rahmen von PPL-Sitzungen (wieder) gesteigert.
Team
Unsere Praxis besteht aus einem Team aus Psychoanalytikern (BBP/DGPT), Psychologen, Ärzten für Psychiatrie und Psychotherapie, Ärzten für psychosomatische Medizin, PPL-Therapeuten und Ernährungsberatern. Regelmäßige Teamsitzungen ermöglichen uns die optimale Umsetzung unseres multimodalen Ansatzes, so dass Sie als Patient bestmöglich werden. Dieses umfangreiche ambulante Setting ist sonst nur im stationären Bereich möglich.Zusammenfassung:
Die Summe dieser Möglichkeiten verleiht unserer Praxis in München ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf die Behandlungsmöglichkeiten einer Depression. Unsere Erfolgsquoten sprechen für sich, sie liegen weit über Durchschnitt. Auch Krankenkassen und Selbstzahlen schätzen unser Angebot, da wir in der Regel deutlich weniger Therapiesitzungen für eine erfolgreiche Behandlung benötigen als der Bundesdurchschnitt, und somit einen deutlichen Beitrag zur Kostensenkung leisten.
Prognose
Die Prognose zur Behandlung einer Depression ist – unabhängig von der Form und Schwere – in der Regel gut bis sehr gut, allerdings unter der Voraussetzung, dass die richtige Diagnose gestellt wurde (inkl. Klassifizierung und Form) und eine fundierte fachliche Therapie durchgeführt wird.